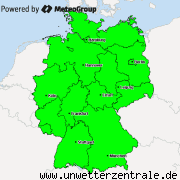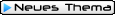| HartzIV: „Fordern und Fördern“ - was hat es gebracht? |
     |
Ihr Lieben,
mit der These, dass man nur viel Druck auf Arbeitslose ausüben müsse, um Erwerbslose wieder in Arbeit zu bringen, wurde Hartz IV von der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder in Kraft gesetzt!
„Fordern und Fördern“ lautete die Devise! Doch, was kam dabei wirklich heraus?
| Zitat: |
Die Wiederentdeckung des Sozialen
Die Gesellschaft hat das Soziale wieder entdeckt. Nach Jahren des radikalen Systemumbaus hin zu einem Staat, der seine Bürger nach Marktkriterien sortiert, sie in nützlich und überflüssig einteilt, die öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert und damit staatlichen Handlungsspielraum abgibt, lichtet sich der Nebel und die Sackgasse wird sichtbar, in die sich der Staat begeben hat.
Ein Kernstück der Ideologie, die in den letzten zehn Jahren hegemonial war, ist der Gedanke, dass man die Krise am Arbeitsmarkt zumindest abdämpfen kann, wenn man auf die Erwerbslosen nur genug Druck ausübt. „Fordern und Fördern“ heißt die Devise, dank derer der „versorgende Sozialstaat“ abgeschafft und „moderne Arbeitsagenturen“ geschaffen werden sollten.
Das Grundprinzip, nachdem die Massenarbeitslosigkeit personifiziert und zu einem individuellen Versagen umdefiniert wird, setzt darauf, das Individuum zu aktivieren, sich fit für den Markt zu machen. Für die Sozialdemokratie ist es angezeigt, eine vorläufige Bestandsaufnahme dieses Systemumbaus vorzunehmen. Das Ergebnis ist verheerend.
Anders als gedacht und gewollt führt das Prinzip des „Fordern und Fördern“ nicht zu hoch qualifizierten, hoch flexibilisierten und hoch motivierten Humankapital, sondern zu gebrochenen Menschen, denen das gesellschaftliche Problem der Arbeitslosigkeit als individuelles Versagen in der Leistungsgesellschaft in die Köpfe gehämmert wird.
Zur Idee des Förderns
Der Weg im Falle von Arbeitslosigkeit ist meist vorgezeichnet. Der Verlust des Arbeitsplatzes hat neben der materiellen, also existentiellen Komponente bereits immer den Beigeschmack des individuellen Versagens. Die Degradierung zum „Versager“ führt erwiesenermaßen nicht selten zu unkonkreter Ablehnung und Trotz. Das zeigt sich durch Wut auf den ehemaligen Arbeitgeber, das System im Allgemeinen und nicht selten durch Sympathie mit politisch extremen Strömungen. Auf diese Phase der Rebellion folgt fast unweigerlich die Resignation.
Gefangen in der Logik von Arbeitsagentur und Job-Center durchläuft man Umschulungen, psychologische Beratungen und Bewerbungstrainings, bis auch das letzte Stück Selbstbewusstsein im Warteraum verloren gegangen ist. Das über die eigene Fähigkeiten definierte Selbstwertgefühl, oft in Jahrzehnten der Erwerbsarbeit angesammelt, wird systematisch zerstört. Schließlich ist – der Logik folgend – nicht der Verlust des Arbeitsplatzes das Problem, sondern der Mensch.
Die erworbene berufliche Qualifikation ist unbrauchbar (Umschulung), die soziale Kompetenz mangelhaft (psychologische Beratung) und die Selbstdarstellung katastrophal (Bewerbungstrainings). Am Ende dieses Kreislaufes ist nicht mehr zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung zu unterscheiden. Die Erfahrungen prägen das Selbstbild, was zu destruktiven Blockaden führt. Jede weitere staatliche Aktivierungsmaßnahme wird nur als nächste individuelle Defizitanalyse verstanden.
Hinzu kommen die vielfältigen Sanktionen und Druckmittel der Arbeitsagenturen und der damit verbundene finanzielle Absturz, der zu einer weiteren (nicht nur gefühlten) Exklusion führt.
All dies zeigt deutlich, dass der Versuch, gesellschaftliche Probleme zu individualisieren und zum persönlichen Defizit umzudefinieren, gescheitert ist. So richtig das Ziel ist, Menschen nicht allein zu lassen, durch Qualifizierungsangebote und sonstige Unterstützung auch neue Perspektiven jenseits des alten Erwerbsverhältnisses zu schaffen, so falsch und gefährlich ist es, den Staat nur noch als Fitnessstudio für den Arbeitsmarkt zu begreifen und Arbeitslosigkeit zum individuellen Problem zu verklären.
Zur Idee des Forderns
Die Instrumente des Förderns korrespondieren mit der Idee des Forderns. Es wurde und wird suggeriert, dass ein Großteil der arbeitslosen Menschen nicht arbeiten wolle und deshalb über Sanktionen dazu gezwungen werden müsse.
Der stärkere Druck gegenüber arbeitslosen Menschen ist Ausdruck von Nützlichkeitserwägungen. Wer nicht bereit ist, sich nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten in die Gesellschaft einzubringen - wobei einbringen stets mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt wird – soll auch kein bzw. wenigstens weniger Geld bekommen.
Die rot-grüne Arbeitsmarktpolitik war in der Folge nicht nur Ausdruck einer Debatte, die ihre widerlichste Erscheinung in der „Sozialschmarotzer-Diskussion“ gefunden hat, sondern hat der Ausbreitung von Nützlichkeitsgedanken Vorschub geleistet. Was hier letztlich geschieht, ist die Aufkündigung humanistischer Grundprinzipien, die ihren Ausdruck u.a. in der Menschenwürdegarantie in Art. 1 Abs. 1 GG gefunden hat.
Jeder Mensch hat in diesem Land eine Existenzberechtigung, unabhängig von seiner nach welchen Kriterien auch immer definierten Nützlichkeit. Dieses Recht, was z.B. auch in einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein „sozio-kulturelles Existenzminimum“ mündet, ist in keinerlei Weise an die Erwerbsfähigkeit oder –bereitschaft gekoppelt, sondern einzig an die Kategorie „Mensch“. Marktprinzipien wie Nützlichkeit und Verwertbarkeit auf Menschen anzuwenden, hat gravierende gesellschaftliche Konsequenzen.
So wächst die Abwertung gegenüber Langzeitarbeitslosen dramatisch, wie in einer Studie untersucht wurde. Knapp die Hälfte der Befragten sind der Auffassung, dass Arbeitslose in Wirklichkeit gar nicht an einem Job interessiert seien. Ein Drittel der Befragten sagt, dass unsere Gesellschaft sich Menschen, die nicht mehr nützlich sind, nicht mehr leisten könne. Dies bedeutet, dass Marktkriterien von Nützlichkeit und Effizienz zunehmend auf das Zusammenleben von Menschen übertragen werden. Drei Viertel der Befragten gaben an, sich darum zu bemühen, in zwischenmenschlichen Kontakten abzuwägen, was ihnen der Kontakt zu der jeweiligen Person gibt. 33, 3 % vertraten, dass sich die Gesellschaft unnützliche Menschen nicht mehr leisten könne und fast 40 % sind sich darin einig, dass in unserer Gesellschaft zu viel Rücksicht auf Versager genommen werde. So alarmierend diese Zahlen sind, so zeigen sie deutlich, dass unsere Gesellschaft nicht mehr nur in wirtschaftlicher Hinsicht als Marktwirtschaft betrachtet werden muss. Der Begriff der Marktgesellschaft scheint zunehmend angebracht, weil Kriterien wie Nützlichkeit, Verwertbarkeit und Effektivität Eingang in soziale Zusammenhänge bekommen. Dieser Entwicklung muss die Sozialdemokratie entgegen treten.
Politische Konsequenzen
Aus den skizzierten Entwicklungen müssen politische Konsequenzen gezogen werden. Gerade die Sozialdemokratie steht hierbei in Verantwortung. Die SPD ist es, die für soziale Gerechtigkeit, für den Aufstieg ärmerer Bevölkerungsgruppen und für eine politische Interessensvertretung alle jener, die keine große Lobby und kein großes Vermögen im Hintergrund haben, steht. Dieser Anspruch darf nicht aufgegeben werden. Ganz im Gegenteil: Die SPD muss hier für einen konsequenten, selbstkritischen und mutigen Kurs stehen, denn gerade in diesem Bereich hat die SPD in den letzten Jahren an Glaubwürdigkeit verloren.
Förderung braucht Arbeitsplätze
Die beschriebenen Entwicklungen machen deutlich: Fördern macht nur Sinn, wenn auch zu etwas gefördert wird, was auch vorhanden ist. Ist dies eben nicht vorhanden, führt dies ausschließlich zur Frustration der betroffenen Personen und damit zum Gegenteil. Sich die Förderung von Arbeitslosen auf die Fahne zu schreiben und sich gleichzeitig nicht darum zu kümmern, dass es auch Arbeitsplätze gibt, macht eben keinen Sinn. Trotz Aufschwung muss zur Kenntnis genommen werden, dass dieser nicht überall ankommt. Die Arbeitslosenquote lag 2007 schließlich noch immer bei 10, 1 %. Davon beträgt die Zahl der Langzeitarbeitslosen 35, 9 %. Zentral bei jedweder Idee des Förderns muss sein, dass die betroffenen Menschen selbst über ihre zukünftige Tätigkeit entscheiden können. Staatliche Förderung bei der Frage, wie sie diese ausüben können, ist richtig, aber nicht bei einer verkrampften Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt. Anstatt sich immer wieder auf die Behauptung zurückzuziehen, der Staat schaffe keine Arbeitsplätze, wäre es doch endlich an der Zeit, in eine Diskussion darüber einzutreten, welche gesellschaftlichen Aufgaben derzeit brachliegen und wie diese in einem öffentlichen Beschäftigungssektor bewerkstelligt werden könnten. Dies würde Arbeitsplätze schaffen und Förderung und Qualifizierung könnte für konkrete Tätigkeiten erfolgen.
Das Sanktionssystem überdenken
Der Sanktionskatalog in § 31 SGB II sieht mehrere Stufen der Sanktionierung vor. In einer ersten Stufe kann es eine Kürzung von 30 % des Regelsatzes geben, wenn der Betroffene z.B. eine Eingliederungsvereinbarung nicht abschließt oder seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Erscheint der Betroffene nicht bei ihm auferlegten Termin wie z.B. ärztlichen Untersuchungen kann eine Kürzung von 10 % erfolgen. Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung erfolgt eine Kürzung um 60 % und danach um Hundert. Erwähnung muss dabei finden, dass auch die Fortsetzung eines unwirtschaftlichen Verhaltens trotz Belehrung die Sanktionierungen in Gang setzen kann. Nicht nur die Frage, nach welchen Kriterien das bestimmt werden soll, sondern ebenso der Widerspruch zu dem Bild eines selbstbestimmten und freien Bürgers drängt sich in dieser Formulierung auf. Die Existenzberechtigung eines jeden Menschen findet seinen Niederschlag u.a. in dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein Existenzminimum. Das Existenzminimum liegt derzeit mit dem ALG II–Regelsatz bei 345 Euro. Es widerspricht jedweder Logik, auf der einen Seite zu behaupten, man bräuchte 345 Euro um die elementarsten Dinge wie Essen, Trinken, Körperhygiene etc. bewerkstelligen zu können, während Menschen, die nicht genügend Bewerbungsschreiben vorweisen können oder womöglich eine psychologische Beratungsstunde vermieden haben, mit bis zu 100 % Kürzungen über die Runden kommen sollen. Außerdem muss politisch dem Einzug von Nützlichkeitserwägungen in zwischenmenschliche Beziehungen entgegengewirkt werden. Folglich sollte zumindest die Kürzung der Bezüge um 100 % ausgeschlossen werden.
Ende der Diskriminierungen von jungen Menschen
Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unterliegen im SGB II insbesondere an zwei zentralen Punkten einer Ungleichbehandlung. Nach § 20 Abs. 2 a SGB II brauchen sie die Zustimmung des kommunalen Trägers um das Elternhaus zu verlassen. Haben sie diese nicht und ziehen trotzdem aus, wird ihr Regelsatz um 80 % gekürzt. Das stellt nicht nur ein eklatante Ungleichbehandlung dar sondern widerspricht auch der Idee eines selbstbestimmten Lebens für jeden Menschen. Liegt eine Voraussetzung nach § 31 Abs. 1 bis 4 SGB II vor, setzt sich nicht das sonstige Sanktionssystem in Gang, sondern sie bekommen umgehend nur noch Leistungen nach § 22 SGB II, d.h. Leistungen für Unterkunft und Heizung. Bei Wiederholung erfolgt die Kürzung um 100 %. Begründet wird diese Ungleichbehandlung damit, dass junge Menschen nach § 3 Abs. 2 SGB II bevorzugt vermittelt werden. Unabhängig davon, dass die unverzügliche Vermittlung von jungen Menschen eventuell noch als Anspruch aber auf keinen Fall als Realität beschrieben werden kann, gibt es keinen sachlichen Grund für eine derart eklatante Ungleichbehandlung in so einer elementaren Frage wie der Befriedigung existentieller Bedürfnisse. Bei Menschen bis zu 25 Jahren entscheidet sich in der Regel viel hinsichtlich der Frage, was das Verhältnis zur Gesellschaft, zur Erwerbsarbeit etc. angeht. Deshalb ist es richtig, bei Jugendlichen darum zu kämpfen, dass sie Chancen auf gute Bildung, gute Ausbildung und gute Arbeit bekommen. Die verschärften Sanktionen führen jedoch zum Gegenteil, weil sie Jugendlichen vermitteln, sich anzupassen und für den Arbeitsmarkt verwertbar zu sein oder weniger Geld, d.h. weniger wert zu sein. Die speziellen Sanktionen für Jugendliche müssen endlich ersatzlos gestrichen werden.
[mehr] |
|
__________________
Liebe Grüße 
Günter

|